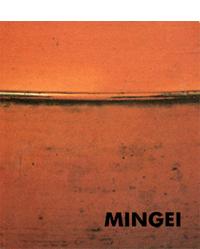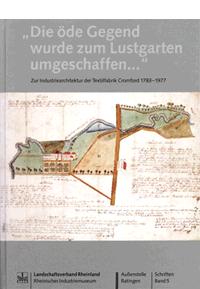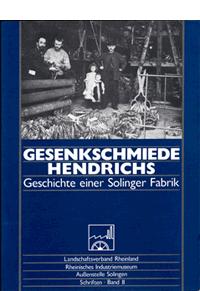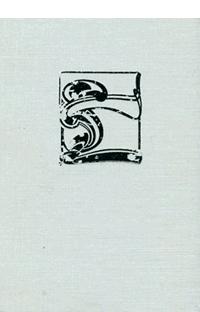|
Gerda Breuer, Ines Wagemann (HG.): Ludwig Meidner (1884–1996). Maler, Zeichner, Literat
2 Bände. Institut Mathildenhöhe, Darmstadt, September - November 1991 (Hatje–Verlag)
Gerda Breuer: Einleitung
Gerhard Leistner: Figur und Landschaft im Frühwerk von Ludwig Meidner
als Prolog zu seinem Verständnis von Expressionismus
Claudia Marquart: Die frühen Selbstbildnisse 1905-1925
Andreas Haus: Ludwig Meidner- Ich-Gestus und Kalligraphie
Heinz Brüggemann: Großstadt und neues Sehen - Ludwig Meidners Anleitung zum Malen
von Großstadtbildern im Kontext der ästhetischen Moderne Europas
Michael Becker: Ludwig Meidner und die frühexpressionistische Großstadtlyrik
Joachim Heusinger von Waldegg: Die Bildnisse Max Herrmann-Neißes.
Zur Ikonographie des expressionistischen Dichterporträts
Angelika Schmid: Die sogenannten „Apokalyptischen Landschaften“ (1912-16)
Susanne Thesing: „Krieg“ - Ein graphischer Zyklus von Ludwig Meidner
Renate Ulmer: „Bin voller heiliger Stimmungen und trage mit mir heroische, bewegte Bibelgestalten herum ...“- Religiöse Kompositionen im Werk Ludwig Meidners
Reinhard Kleber, Angelika Schmid: Ludwig Meidner und der Film - Eine Spurensuche
Winfried Flammann: Das druckgraphische Werk von Ludwig Meidner
Michael Assmann: „Stoßseufzer eines alternden Ekstatikers“ - Ludwig Meidners Feuilletons
und die Erzählungen aus dem Nachlaß (1927-1932)
Helen Adkins: Ludwig Meidner in England - Vierzehn Jahre eines erbärmlichen Lebens
Joseph Paul Hodin: Else und Ludwig Meidner in England
Claus K. Netuschil: Ludwig Meidner - Ein malerischer Realist. Anmerkungen zum Alterswerk
|
|
 |
 |
 |
|
Gerda Breuer (HG.): Mingei. Japanische Volkskunst. Sammlung Montgomery
Ateliers des Museums Künstlerkolonie, Mathildenhöhe Darmstadt
Das japanische Mingei (=Volkskunst) hat deutsche und englische Architekten und Kunsthandwerker wie Bruno Taut und Bernhard Leach fasziniert. Mit dem Begriff verbindet sich eine Art „Gebrauchskultur“ der Dinge; er berichtet von der Gegenstandsbeziehung der Menschen und, da sich seine Prinzipien auf Kleidung, Haus, Sprache und Habitus im Alltag übertrug, gleichzeitig auch von deren Lebenskultur. Der Begriff „Mingei“ wird meist verbunden mit dem Leiter des Museums für Volkskunst in Tokio, Soetsu Yanagi, der dieses Handwerk in den 1920er Jahren des 20. Jahrhunderts in Abhebung zur industriellen Massenware und der verwestlichten Kulturindustrie sammelte und präsentierte.
|
|
 |
 |
 |
|
Krefelder Kunstmuseen (Konzeption und Durchführung: Gerda Breuer):
Der westdeutsche Impuls 1900–1914. Kunst und Umweltgestaltung im Industriegebiet. Von der Künstlerseide zur Industriefotografie – Das Museum zwischen Jugendstil und Werkbund
Die Ausstellung war eigenständiger Teil einer Verbundausstellung in NRW. Beteiligt waren 6 Städte: neben Krefeld Düsseldorf, Wuppertal, Köln, Essen und Hagen. Es wurde untersucht, welche kulturellen Initiativen zu freier und angewandter Kunst im Gebiet zwischen Rhein und Ruhr, das gemeinhin als Werkstatt der Nation galt, in der Zeit der Jahrtausendwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieg zu verzeichnen waren. Thematisch waren die einzelnen Ausstellungen je nach lokaler Besonderheit unterschiedlich ausgerichtet.
Der Krefelder Teil verglich zwei Museumstypen: Den des Kaiser Wilhelm Museums, das Friedrich Deneken, der erste Direktor, mit zahlreichen Jugendstilkünstlern und thematischen Ausstellungen realisierte, sowie den des „Museums für Kunst in Handel und Gewerbe“ von Karl Ernst Osthaus, dessen Bestände das Kaiser Wilhelm Museum 1923 nach dem Tod des Hagener Mäzens kaufte und das bis zu diesem Zeitpunkt, mit Ausnahme der Plakate, noch nicht ausgestellt worden war.
Die Krefelder Ausstellung rekrutierte sich folglich ausschließlich aus eigenen Beständen.
Autoren des Katalogen sind neben Gerda Breuer: Klaus-Jürgen Sembach, Sebastian Müller, Carl W. Schümann, Karin Wilhelm und Claus Pfingsten.
|
|
 |
 |
 |